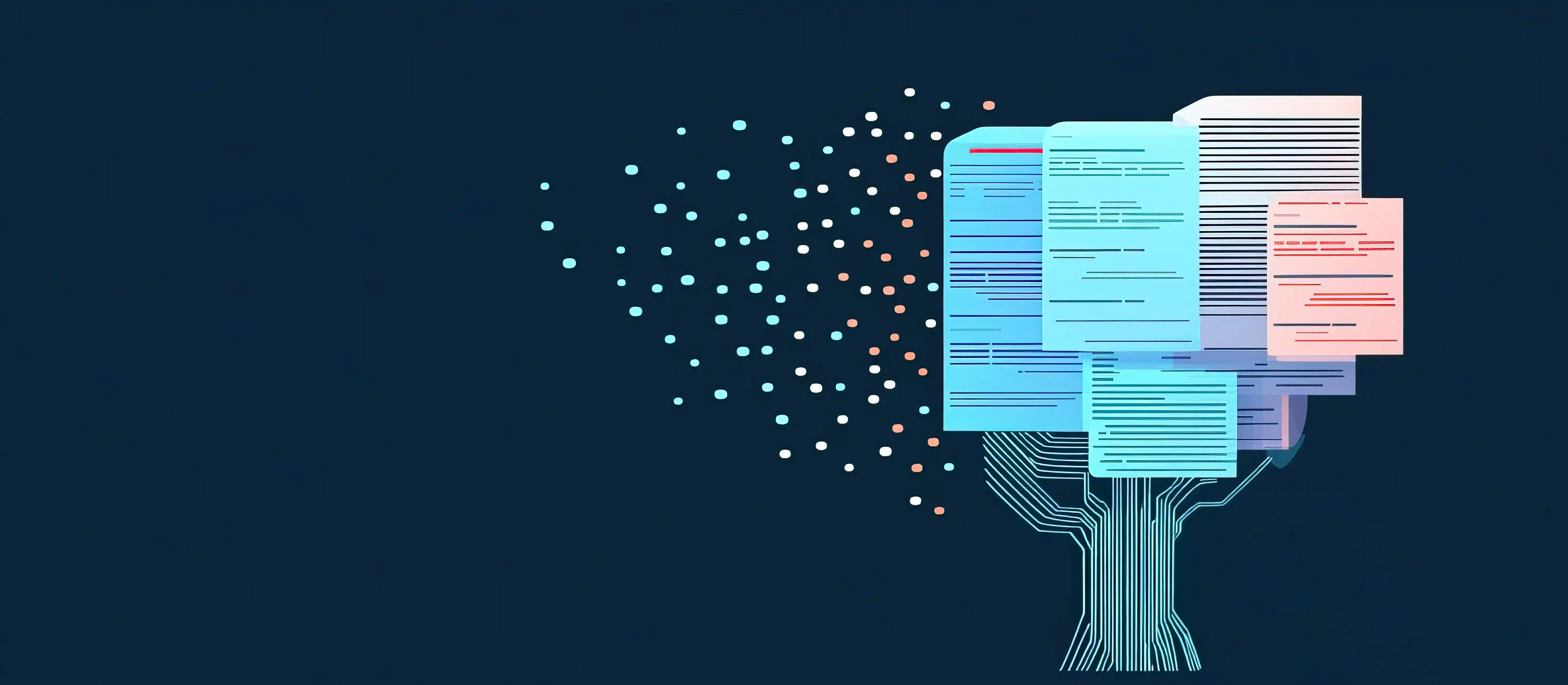Seit Jahren wurde das digitale Marketing von Third-Party-Daten angetrieben – Informationen, die über verschiedene Websites hinweg gesammelt und für Targeting und Analysen neu aufbereitet wurden. Dieses System ermöglichte programmatische Werbung in großem Maßstab, beruhte jedoch auf intransparenten Tracking-Praktiken.
Dieses Modell begann zusammenzubrechen, als Google erstmals die Abschaffung von Third-Party-Cookies ankündigte – und der Trend hält bis heute an, auch nachdem Google die Umsetzung mehrfach verschoben hat. Safari und Firefox blockieren Third-Party-Cookies bereits seit Jahren über ITP bzw. ETP (Apple, 2017; Mozilla, 2019). Google Chrome, mit rund 65 % Marktanteil weltweit, startete 2024 die schrittweise Deaktivierung und weitete sie 2025 im Rahmen der Privacy Sandbox aus (Google, 2024; StatCounter, 2025).
Für Unternehmen geht es dabei längst nicht mehr nur um Compliance-Fragen, sondern um eine grundlegende Neuausrichtung der Datenstrategie. Sie müssen unterscheiden zwischen:
- Zero-Party-Daten: Informationen, die Nutzer*innen freiwillig teilen,
- First-Party-Daten: Informationen, die Unternehmen über eigene Kanäle erheben, und
- Third-Party-Daten: Daten, die einst reichlich vorhanden waren, nun aber zunehmend verschwinden.
Die Auswirkungen reichen weit über Werbung hinaus. Marketing-Teams müssen Personalisierung neu denken, wenn Third-Party-Audiences wegfallen. Analytics-Teams stehen vor neuen Herausforderungen bei Attribution und Erfolgsmessung, da bisherige Tracking-Methoden zunehmend versagen.
In diesem Artikel wird erläutert, was Zero-, First- und Third-Party-Daten eigentlich sind, wie sie sich unterscheiden und warum diese Unterschiede heute entscheidend für alle sind, die in Marketing, Analytics oder Compliance arbeiten.
Datentypen und ihre Funktionen
Zero-Party-Daten: bewusst vom Nutzer geteilt
Zero-Party-Daten sind Informationen, die Kundinnen aktiv und freiwillig einem Unternehmen zur Verfügung stellen. Dazu gehören etwa Produktpräferenzen, Kommunikationswünsche oder Antworten auf Umfragen und Quizze. Im Gegensatz zu anderen Datenarten müssen sie nicht interpretiert oder getrackt werden – die Nutzerinnen übermitteln sie direkt.
Beispiele: Ein Newsletter-Anmeldeformular, bei dem Themeninteressen ausgewählt werden, ein Präferenzcenter in einer App oder ein Quiz, das passende Produkte auf Basis der angegebenen Vorlieben empfiehlt.
Warum das relevant ist: Diese Daten sind besonders präzise, weil sie tatsächliche Absichten widerspiegeln, und besonders datenschutzkonform, da sie freiwillig und transparent übermittelt werden – im Einklang mit den Anforderungen der DSGVO an Transparenz und informierte Einwilligung.
First-Party-Daten: direkt vom Unternehmen erhoben
First-Party-Daten sind Informationen, die ein Unternehmen über seine eigenen Kanäle sammelt, wenn Nutzerinnen mit seiner Website, App, E-Mails oder physischen Filialen interagieren. Im Gegensatz zu Zero-Party-Daten werden sie nicht immer aktiv bereitgestellt, sondern entstehen durch das Verhalten der Kundinnen.
Beispiele: Website-Analysen (Seitenaufrufe, Klickpfade), Kaufhistorien, CRM-Daten, E-Mail-Engagement oder App-Nutzungsmuster.
Erhebungsmethoden: häufig über First-Party-Cookies, SDKs, Server-Side-Tracking oder Loyalty-Programme.
Warum das relevant ist: First-Party-Daten sind das Rückgrat moderner Analysen. Sie sind zuverlässig, liegen unter der Kontrolle des Unternehmens und gelten als zukunftssicher im Vergleich zu Third-Party-Daten. Dennoch ist in vielen Rechtsräumen eine Einwilligung erforderlich, wenn Cookies oder Tracking-Technologien verwendet werden.
Third-Party-Daten: aggregiert und extern bezogen
Third-Party-Daten werden von Akteuren gesammelt, die keine direkte Beziehung zu den Nutzer*innen haben. Diese Daten werden über verschiedene Websites oder Apps hinweg aggregiert, zu Zielgruppen-Segmenten gebündelt und anschließend zu Werbe- oder Analysezwecken verkauft.
Beispiele: Zielgruppen-Segmente, die von einem Datenbroker gekauft wurden, oder Third-Party-Cookies, die das Nutzerverhalten über mehrere Websites hinweg nachverfolgen.
Warum das relevant ist: Third-Party-Daten waren lange die Grundlage programmatischer Werbung und ermöglichten Cross-Site-Retargeting sowie eine großflächige Reichweitenerweiterung. Doch ihre Bedeutung nimmt rapide ab – Browser blockieren sie zunehmend, und Regulierungsbehörden prüfen ihre Nutzung kritisch. Ihre Zuverlässigkeit ist zudem fragwürdig, da Nutzer*innen selten wissen, wer die Daten sammelt oder wie genau sie tatsächlich sind.
Wie sie sich in der Praxis unterscheiden
Obwohl alle drei Kategorien oft gemeinsam genannt werden, unterscheiden sie sich deutlich in Erhebungsmethoden, Zuverlässigkeit, Kontrolle und Compliance.
Erhebungsmechanismus
- Zero-Party-Daten werden aktiv von Nutzer*innen bereitgestellt (z. B. Umfragen, Präferenzeinstellungen).
- First-Party-Daten werden passiv durch Interaktionen erfasst (z. B. Website-Besuche, Käufe).
- Third-Party-Daten werden indirekt von externen Akteuren gesammelt, meist ohne direkte Beziehung zur betroffenen Person.
Zuverlässigkeit und Genauigkeit
- Zero-Party-Daten sind explizit, aber inhaltlich begrenzt – geäußerte Präferenzen stimmen nicht immer mit tatsächlichem Verhalten überein.
- First-Party-Daten spiegeln reales Verhalten wider und sind daher besonders wertvoll für Verhaltensanalysen.
- Third-Party-Daten sind oft intransparent und qualitativ uneinheitlich, mit veralteten oder ungenauen Segmenten.
Eigentum und Kontrolle
- Zero- und First-Party-Daten liegen im Besitz des Unternehmens, werden intern gespeichert und sind leichter zu prüfen.
- Third-Party-Daten sind „gemietet“ – der Zugriff hängt von externen Anbietern ab, die Bedingungen ändern oder Datenquellen einstellen können.
Compliance und Transparenz
- Zero-Party-Daten sind am stärksten konform, da sie bewusst und freiwillig bereitgestellt werden.
- First-Party-Daten sind in der Regel zulässig, wenn eine gültige Einwilligung vorliegt (besonders bei Cookies oder Tracking-Technologien).
- Third-Party-Daten sind rechtlich am riskantesten, da sie oft ohne klare Einwilligungspflicht erhoben werden – einer der Hauptgründe für ihren technischen und regulatorischen Rückgang.
Insgesamt zeigen diese Unterschiede, warum Marketer, Analyst*innen und Rechtsteams ihre Datenstrategien überdenken müssen. Zero- und First-Party-Daten stehen für Nachhaltigkeit und Vertrauen, während die Zukunft von Third-Party-Daten – technisch wie rechtlich – zunehmend begrenzt ist.
Auswirkungen auf verschiedene Teams
Marketing-Teams: Personalisierung unter neuen Rahmenbedingungen
Das Ende der Third-Party-Cookies schränkt die Möglichkeit ein, Nutzer*innen über das offene Web hinweg erneut anzusprechen oder große Lookalike-Audiences zu bilden. Für Marketing-Teams bedeutet das eine Verschiebung von Reichweite hin zu Beziehungspflege.
- Personalisierung und Segmentierung basieren zunehmend auf Zero- und First-Party-Daten. Präferenzcenter, Treueprogramme und E-Mail-Marketing werden zu zentralen Werkzeugen. Eine Gartner-Studie aus dem Jahr 2024 ergab, dass 71 % der Marketer ihre Investitionen in Loyalty-Programme erhöhen wollen, um auf die Abschaffung der Cookies zu reagieren (Gartner, 2024).
- Von Programmatic Advertising zu Relationship Marketing: Strategien wandeln sich von anonymen Third-Party-Segmenten hin zu Communitys, Markenmitgliedschaften und eigenen Kanälen.
- E-Mail- und CRM-Systeme gewinnen wieder an Bedeutung – sie sind langfristig tragfähige Kanäle, in denen Interaktionen transparent und datenschutzkonform nachvollzogen werden können.
Analytics- und Data-Science-Teams: Arbeiten mit Datenlücken
Analytics-Expert*innen stehen vor der Herausforderung, Nutzerverhalten mit immer weniger externen Signalen zu modellieren.
Datenqualität vor Datenmenge: Mit kleineren, aber reichhaltigeren Zero- und First-Party-Datensätzen zählen Genauigkeit und Vollständigkeit mehr als Volumen. Fehlerhafte Einwilligungen oder fragmentierte Datenpipelines können wertvolle Insights zunichtemachen.
Server-Side-Tracking gewinnt an Bedeutung, da Unternehmen damit den Datenfluss selbst kontrollieren können – statt auf browserbasierte Methoden zu setzen, die zunehmend blockiert werden (Forrester, 2023).
Customer Data Platforms (CDPs) helfen, Datensilos zu vermeiden, indem sie Informationen aus unterschiedlichen Touchpoints zusammenführen und so eine einheitliche Datenbasis schaffen.
Machine Learning mit begrenzten Datensätzen: Analyst*innen müssen Modelle entwickeln, die auch mit kleineren, datenschutzkonformen Datensätzen präzise Vorhersagen treffen. Die Qualität der Eingabedaten entscheidet hier über die Aussagekraft der Modelle.
Cross-Device- und Omnichannel-Attribution wird schwieriger, da Third-Party-Signale entfallen. Neue Ansätze wie probabilistische Attribution oder Privacy-Preserving-Modelle in Data Clean Rooms gewinnen an Relevanz.
Legal- und Compliance-Teams
Rechtsabteilungen müssen sicherstellen, dass neue Datenstrategien sowohl gesetzlichen Anforderungen als auch den Erwartungen der Nutzer*innen entsprechen.
Regulatorische Anforderungen: DSGVO, CCPA und neuere Gesetze wie der Digital Markets Act betonen Transparenz und die Notwendigkeit ausdrücklicher Einwilligung, insbesondere bei Cookies und Tracking-Technologien.
Einwilligungs-Frameworks: Aktualisierungen wie das Transparency and Consent Framework (TCF 2.2) des IAB Europe (2023) prägen, wie Einwilligungen erfasst und an Ad-Tech-Partner übermittelt werden.
Risikomanagement: Die Nutzung von Third-Party-Daten birgt zunehmende Compliance-Risiken, da Datenhändler oft keine nachweislich gültigen Einwilligungen vorlegen können. Steigende Bußgelder gegen Unternehmen wie Meta oder TikTok zeigen, dass Behörden Tracking-Praktiken stärker in den Fokus nehmen.
Datensouveränität und Lokalisierung: Da immer mehr Länder lokale Speicherpflichten einführen, müssen Rechtsteams klären, wie und wo Zero- und First-Party-Daten verarbeitet werden dürfen.
Strategische Veränderungen in der Datenerhebung
Das Aus für Third-Party-Cookies
Die sichtbarste Veränderung bleibt die Abschaffung von Third-Party-Cookies. Google Chrome, mit rund 65 % Marktanteil (StatCounter, 2025), begann 2024 mit der Deaktivierung für 1 % der Nutzer*innen und weitete sie 2025 im Rahmen der Privacy Sandbox aus. Zwar sollen neue Technologien wie Topics API oder Attribution Reporting Werbefunktionalitäten erhalten, doch ihre Effektivität und Akzeptanz sind unter Werbetreibenden und Aufsichtsbehörden weiterhin umstritten.
Server-Side-Tracking für mehr Datenkontrolle
Da Browser Client-Side-Tracking zunehmend einschränken, wird Server-Side-Tagging zur zentralen Lösung für eine widerstandsfähige Dateninfrastruktur. Statt auf anfällige Browser-Cookies zu setzen, wird die Datenerfassung über die eigene Serverinfrastruktur gesteuert. Unternehmen gewinnen so mehr Kontrolle über Datenqualität, Governance und Compliance.
Datenlücken mit KI-basierten Lösungen schließen
KI-Modelle helfen, aus hochwertigen Datensätzen mehr Wert zu ziehen. Machine-Learning-Tools erkennen Muster, identifizieren Nutzerabsichten und optimieren Kampagnen, selbst wenn weniger Signale verfügbar sind – vorausgesetzt, die zugrunde liegenden First- und Zero-Party-Daten sind präzise. Laut McKinsey (2024) erzielen Unternehmen, die auf KI-getriebene Personalisierung setzen, Umsatzsteigerungen von 10–20 % trotz restriktiverer Datenschutzumgebungen. JENTIS-Kund*innen erreichten durch die Aktivierung verlorener Conversions mit synthetischen Daten sogar bis zu 25 % ROAS-Steigerung.
Vertrauen der Verbraucher*innen als neue Währung
Das Vertrauen der Konsument*innen entwickelt sich zur entscheidenden Erfolgsgröße. Transparenz und Kontrolle sind längst kein „Nice-to-have“ mehr, sondern prägen die Markenwahrnehmung. Laut Cisco’s Consumer Privacy Survey 2024 gaben 76 % der Befragten an, sie würden nicht bei Unternehmen kaufen, denen sie beim Umgang mit Daten nicht vertrauen. Vertrauen wird damit zu einem Wettbewerbsvorteil – nicht nur zu einer Compliance-Aufgabe.



.webp)